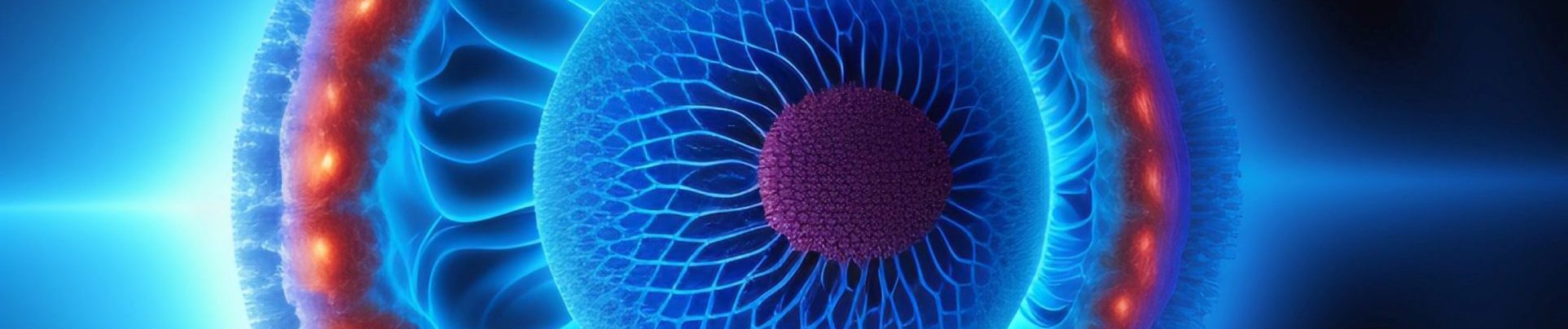Nachdem die bisher gültige Anwendungsnorm für Sprachalarmanlagen (SAA) bereits von 2014 stammte, wurde im Juni 2024 eine überarbeitete Neuausgabe veröffentlicht. Sie enthält zahlreiche Änderungen, etwa zur Ermittlung der Sprachverständlichkeit sowie zur Bewertung von Störgeräuschen und raumakustischen Randbedingungen. Die Einarbeitung zweier verbindlicher Planungsverfahren sowie viele Vereinfachungen zur Erreichung des Schutzzieles und zur Energieversorgung sollen die Norm praxisnäher machen und so zu erhöhter Akzeptanz führen.

Aktualisiert wurde auch die Struktur der Norm. Sie orientiert sich an den einzelnen Phasen nach DIN 14675 und der Organisation zukünftiger Ausgaben der Normenreihe DIN VDE 0833. Wenngleich es die aktuelle Baupraxis oft nicht zulässt, die einzelnen Phasen in der konkreten chronologischen Reihenfolge abzuarbeiten, wird nun normativ nochmals verdeutlicht, dass eine aufeinander aufbauende Abfolge der Leistungserbringung unumgänglich ist. So wird für Bauherren/Betreiber und die beteiligten Fachplaner klar zum Ausdruck gebracht, dass bereits in der Konzeptphase sämtliche Grundlagen zur Planung einer Sprachalarmanlage erarbeitet werden müssen.
Auf die Abfolge kommt es an
Dies umfasst Anforderungen an den Beschallungsumfang, Festlegungen zum Räumungskonzept, zur Ausfallsicherheit, zur Definition der Alarmierungsbereiche, zum Standort und der Zugänglichkeit der Zentralen, der Notwendigkeit von Notfallmikrofonen, der vorgesehenen Nutzung von IT-Komponenten für die SAA sowie besondere Anforderungen an die Brandfalldurchsage (BFD). Auch müssen bereits in der Konzeptphase die akustischen Rahmenbedingungen zur Planung der SAA ermittelt werden. Dazu gehört unter anderem die Festlegung der Störgeräuschpegel und Mindestanforderungen an die Raumakustik.
Die Verantwortung in der Konzeptphase trägt zwar der Bauherr/Betreiber, er wird die beschriebenen Leistungen jedoch zumeist nicht ohne Unterstützung eines Fachplaners erbringen können. Die in der Konzeptphase erfolgten Festlegungen müssen in einem Sprachalarmkonzept oder einem Brandmelde- und Alarmierungskonzept dokumentiert werden.
Vereinfachte vs. ausführliche Planung
Die Planung baut dann auf die in der Konzeptphase dokumentierten Festlegungen auf. Durch die normative Vorgabe zweier unterschiedlicher Planungsverfahren für die Dimensionierung der SAA und die bereits in der Konzept- phase dokumentierten akustischen Rahmenbedingungen werden die Fachplaner in Zukunft für jeden mit der SAA zu versorgenden Bereich entscheiden müssen, welches Verfahren zur Anwendung kommen muss. Oft wird es das vereinfachte Planungsverfahren sein. Um es anwenden zu können, müssen bestimmte akustische Bedingungen erfüllt sein, sonst wird ein Planungsverfahren notwendig. Grundsätzlich muss die Auslegung derart erfolgen, dass in jedem zu versorgenden Bereich mindestens ein A-bewerteter äquivalenter Dauerschalldruckpegel von 75 dB erreicht wird.
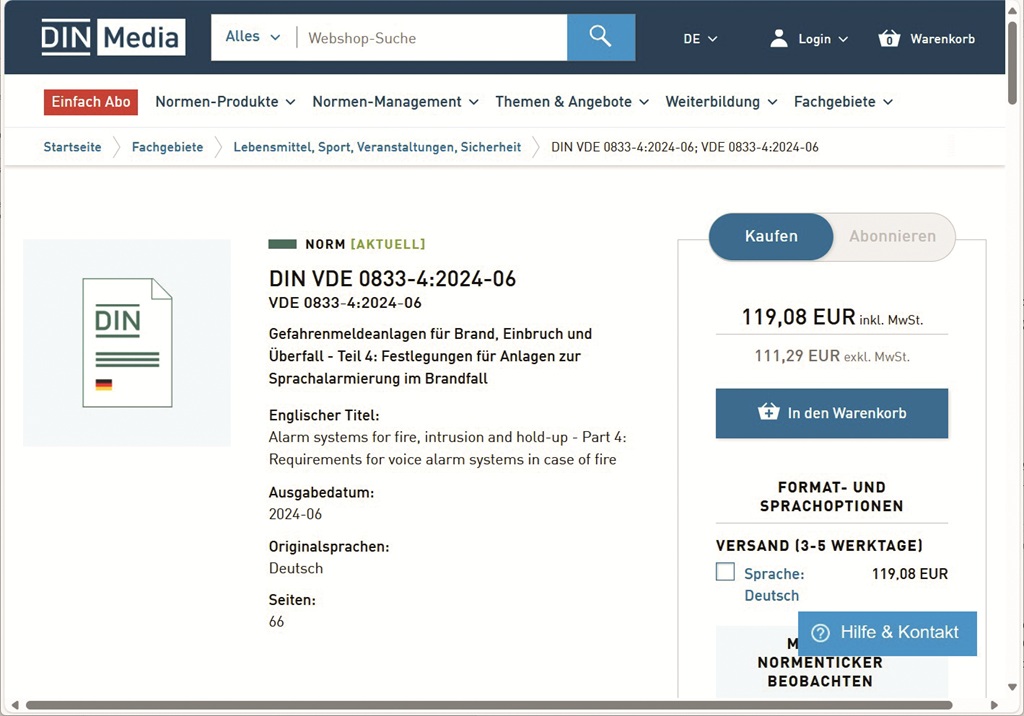
Normativ wird jedoch besonders darauf hingewiesen, dass die Auslegung des notwendigen Schalldruckpegels stets in Abhängigkeit von den zu erwartenden Störgeräuschen erfolgen muss. Beim vereinfachten Planungsverfahren darf dabei das Verhältnis der Summenpegel von Nutz- und Störschallpegel betrachtet werden. Der A-bewertete Störabstand muss mindestens 15 dB betragen und der Summenpegel der Störgeräusche darf 65 dB (A) nicht überschreiten. Ferner ist das Verfahren nur für Lautsprecher anwendbar, die vertikal von oben nach unten frei abstrahlen können und in einer maximalen Höhe von 6 m über dem Fußboden positioniert sind. So wird bei einem – normativ vorgegebenen – gleichmäßigen maximalen Lautsprecherabstand gleich der doppelten Entfernung zwischen Ohrund Montagehöhe eine auskömmliche Beschallung erreicht.
Diese vereinfachte Betrachtung ist jedoch nur zulässig, wenn die raumakustischen Voraussetzungen dies zulassen: So darf die Nachhallzeit für die Oktavbänder von 500 Hz bis 4 kHz nicht größer als 1 Sekunde sein, oder es müssen bestimmte Raumgruppen gemäß DIN 18041 (Hörsamkeit in Räumen) vorliegen.
Voraussetzungen für das ausführliche Verfahren
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist das ausführliche Planungsverfahren anzuwenden. Grundsätzlich gilt nun, dass die Sprachverständlichkeit auf Grundlage einer Simulation zu berechnen ist. Dafür muss das planende Fachpersonal über hinreichende raum- und elektroakustische Kompetenz verfügen, nicht zuletzt, um sowohl Möglichkeiten als auch Grenzen der verwendeten Simulationsprogramme erkennen und anwenden zu können. Es ist jedoch normativ keineswegs beabsichtigt, dass im Rahmen des ausführlichen Planungsverfahrens immer auch simuliert werden muss. Liegen bereits positive Erfahrungswerte aus Messungen oder Simulationen für Räume mit hinreichender Übereinstimmung vor, können die Beschallungsansätze dieser repräsentativen Lösungen weiterverwendet werden, ohne dass erneut simuliert werden muss.
Die hinlängliche Übereinstimmung der repräsentativen Räume muss dabei bezüglich der Raumabmessungen und der raum- und elektroakustischen Rahmenbedingungen gegeben sein, und es obliegt einer fachkompetenten planerischen Entscheidung, diese Übereinstimmung festzustellen. Es ist zu erwarten, dass in der Zukunft für bestimmte wiederkehrende Objekte Standardlösungen verfügbar werden. So könnten beispielsweise für Klassenzimmer, Turnhallen, Büroräume und ähnliche, stets wiederkehrenden Raumtypen bereits verifizierte Ergebnisse für die Sprachverständlichkeit in Zusammenhang mit bestimmten Beschallungslösungen gegeben und herangezogen werden.
Sprachverständlichkeit
In jedem Fall werden sich die Planenden bei der Anwendung des ausführlichen Planungsverfahrens explizit mit dem Thema der Sprachverständlichkeit und der Störgeräusche auseinandersetzen müssen. Bei der Ermittlung der Sprachverständlichkeit erfolgte eine Anpassung an andere internationale Normen. So wird in Zukunft die durchschnittliche Sprachverständlichkeit (bewertet durch den Sprachübertragungsindex STI) für die besten 90 % der Fläche eines sogenannten ADA ermittelt. Darüber hinaus darf der kleinste STI-Wert innerhalb der zu bewertenden 90 % ein vorgegebenes Minimum nicht unterschreiten.
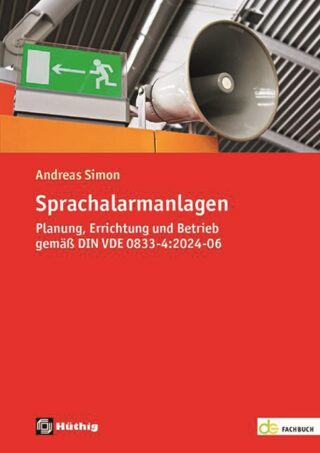 (Bild: Hüthig)Ein ADA kann ein Unterbereich eines Alarmierungsbereiches oder gar eines Raumes sein, der dadurch gekennzeichnet ist, eigene raumakustische Eigenschaften zu besitzen und/oder individuelle Störgeräusche aufzuweisen. Ein klassisches Beispiel hierfür ist ein Eingangsfoyer, bei dem sich im Eingangsbereich eine absorptive Abhangdecke und ein Teppich befinden und wo sich der Raum nach einigen Metern in die eigentliche Eingangshalle erweitert, die sich oft über mehrere Stockwerke erstreckt und außerdem mit schallharten Materialien wie Glas und Beton ausgeführt ist. Hier ist es offensichtlich, dass sich die akustischen Eigenschaften in den Teilbereichen erheblich unterscheiden können und somit eine Unterteilung in mindestens zwei ADA mit separater Bewertung der Sprachverständlichkeit notwendig wird.
(Bild: Hüthig)Ein ADA kann ein Unterbereich eines Alarmierungsbereiches oder gar eines Raumes sein, der dadurch gekennzeichnet ist, eigene raumakustische Eigenschaften zu besitzen und/oder individuelle Störgeräusche aufzuweisen. Ein klassisches Beispiel hierfür ist ein Eingangsfoyer, bei dem sich im Eingangsbereich eine absorptive Abhangdecke und ein Teppich befinden und wo sich der Raum nach einigen Metern in die eigentliche Eingangshalle erweitert, die sich oft über mehrere Stockwerke erstreckt und außerdem mit schallharten Materialien wie Glas und Beton ausgeführt ist. Hier ist es offensichtlich, dass sich die akustischen Eigenschaften in den Teilbereichen erheblich unterscheiden können und somit eine Unterteilung in mindestens zwei ADA mit separater Bewertung der Sprachverständlichkeit notwendig wird.
Die Anforderungen an die Sprachverständlichkeit werden in Zukunft in Grundanforderungen und reduzierte Anforderungen unterteilt. Bei ersteren ist ein 90 %-Mittelwert von 0,5 STI und ein 90 %-Minimalwert von 0,45 STI zu erreichen. Sind die Voraussetzungen zur Anwendung der reduzierten Anforderung an die Sprachverständlichkeit erfüllt, sinken diese Werte auf 0,45 bzw. 0,4. Die Voraussetzungen zur Reduzierung der Anforderungen an die Sprachverständlichkeit sind im Prinzip aus der Bestandsnorm übernommen worden. Sollte die SAA (ab Sicherheitsstufe II) zum Beispiel durch den Ausfall eines Übertragungsweges in den Havariezustand gehen, so können die reduzierten Anforderungen in Ansatz gebracht werden. Ebenso ist dies möglich, wenn nur feste Personenkreise alarmiert werden müssen und diese Personen an regelmäßigen Übungen teilnehmen.
Die Möglichkeit zur Reduktion der Anforderungen ist jedoch auch bei „besonders komplizierten akustischen Randbedingungen“ gegeben. Hierbei muss bereits in der Planung durch Simulation nachgewiesen werden, dass unter Berücksichtigung sämtlicher ausführbarer raumakustischer Maßnahmen und anlagentechnischen Modifikationen die Grundanforderungen nicht zu erreichen sind. Zu Letzteren gehören unter anderem der gezielte Einsatz von Equalizern, eine Dynamikkompression zur Erhöhung des Schallpegels sowie die Wahl der bestmöglich geeigneten Lautsprecher.
Eine besondere Herausforderung für die Fachplanenden stellt die Ermittlung der Störgeräusche dar. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier auch in der neuen Norm keine Vereinfachungen gefunden werden konnten. Die Bemessung von Störgeräuschen kann sehr komplex sein und muss außerdem immer spektral erfolgen. Sie erfordert deshalb eingehende Fachkenntnisse. Idealerweise werden Störgeräusche im konkreten oder in einem damit vergleichbaren Objekt messtechnisch ermittelt. Ist dies nicht möglich, dürfen Prognoseberechnungen angestellt werden. Die einschlägige Fachliteratur gibt hierzu ausführliche, für Fachplanende aufbereitete Hinweise.
Strengere Anforderungen an Brandfalldurchsage
Die Wirksamkeit einer SAA wird größtenteils durch die raum- und elektroakustischen Gegebenheiten bestimmt. Sie kann jedoch selbst bei technisch hinlänglicher Planung und Auslegung teilweise oder sogar vollständig verfehlt werden, wenn die eigentliche Brandfalldurchsage (BFD) nicht derart gestaltet und produziert wurde, dass eine maximale Wirksamkeit erzielt werden kann. Aus diesem Grund wurden in der Neuausgabe umfangreiche Anforderungen an die BFD aufgenommen. Die Produktion soll möglichst in tonstudioähnlichen Umgebungen erfolgen und der Text professionell eingesprochen sein.
Neben weiteren Aspekten sind bereits in der Konzeptphase die individuelle Gebäudestruktur, die sich darin befindlichen Personen (ggf. mehrsprachige Durchsagen) und die Nutzung des Gebäudes bei der inhaltlichen Abstimmung der BFD zu berücksichtigen. Eine bestehende Gefahr ist klar zu bezeichnen, und gezielte Falschinformationen haben zu unterbleiben, wie die Benennung des Brandfalls als „Technische Störung“.
Erleichterungen bei der Energieversorgung
Sprachalarmanlagen sind häufig mit einer signifikanten Investitionshöhe verbunden. Somit sind die in der Neuausgabe reduzierten Anforderungen an die Energieversorgung durchaus positiv zu werten. Jede SAA muss neben der elektrischen Versorgung aus dem öffentlichen oder einem vergleichbaren Netz über eine Ersatzenergieversorgung verfügen. Zukünftig ist es möglich, die zu leistende Überbrückungszeit nach Ausfall der Hauptenergieversorgung auf eine Stunde zu reduzieren, wenn die SAA an einer Sicherheitsstromversorgung betrieben wird, die bauordnungsrechtlich gefordert ist. Diese Anforderung wird zumeist im Brandschutzkonzept aufgestellt.
Eine weitere Reduktion der Überbrückungszeit auf nur eine halbe Stunde ist dann möglich, wenn in der Alarmorganisation, oft aber auch in der Betriebsbeschreibung des Objektes, festgelegt wird, dass das Gebäude bei Ausfall der Hauptenergieversorgung stets sofort zu evakuieren ist. Die Dimensionierung ist derart vorzunehmen, dass nach Ablauf der Überbrückungszeit noch eine komplette Alarmierung durchgeführt werden kann. So entspricht die Alarmierungszeit der doppelten Evakuierungszeit, jedoch stets mindestens einer halben Stunde.
Vereinfachte Inspektionen
Für den Betreiber einer SAA sind nicht zuletzt auch die laufenden Aufwendungen in der Betriebsphase relevant. Auch hierzu wird in der neuen Anwendungsnorm entsprechend aufgeklärt: Inspektionen und Wartungsleistungen werden vom Betreiber der SAA im Regelfall an ein entsprechendes Fachunternehmen beauftragt. Im eigenen Verantwortungsbereich des Betreibers liegen jedoch die vier Mal im Jahr durchzuführenden Begehungen. Diese müssen durch eine sachkundige und auf die SAA eingewiesene Person oder durch eine Fachfirma vorgenommen werden. Im Rahmen der Begehung überprüft werden die Raumnutzung und Raumgestaltung, eventuelle Nutzungsänderungen, eine freie Abstrahlung sämtlicher Lautsprecher und mechanische Beschädigungen oder Mängel an der Befestigung.
Das zu beauftragende Fachunternehmen hingegen übernimmt die in DIN VDE 0833-1 und DIN VDE 0833-2 festgelegten Aufwendungen zur Instandhaltung und Wartung. Bezüglich der Instandhaltung kann ebenfalls von mindestens vier Terminen ausgegangen werden, wobei bei einem der Termine auch die Wartung durchgeführt werden kann. Im Rahmen der Instandhaltung muss einmal jährlich auch die Funktion und verzerrungsfreie Wiedergabe der Lautsprecher mit Sprachsignalen überprüft werden.